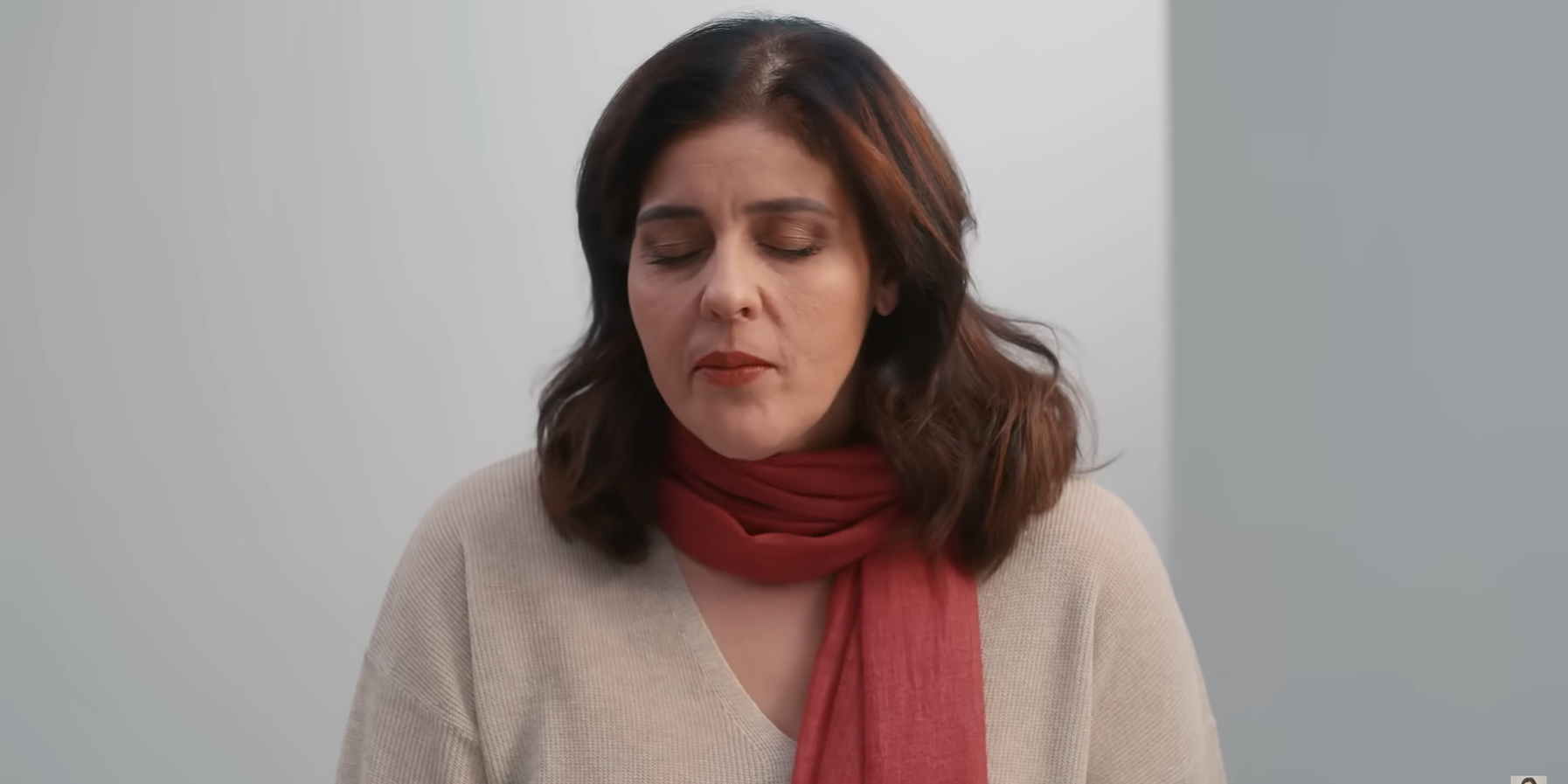Text: Stefan Franzen, Stand: 01.01.2025
Was verbinden wir in Europa mit dem Begriff »arabisches Lied«? Sicherlich denken viele von uns, die ein Faible für orientalische Töne haben, zunächst an die einmalige Gesangskunst der Ägypterin Oum Kalthoum (1904–1975). Über Jahrzehnte hinweg holte sie allabendlich Millionen von Hörern vor die Radiogeräte. Eine Stunde lang konnte so ein »Lied« dauern, in dem Kalthoum in reichen Metaphern über die (meist vergebliche oder gescheiterte) Liebe sang, begleitet von opulenten, melismatischen Orchesterklängen, für die der Produzent Mohamed Abdel Wahab verantwortlich zeichnete.
Oder wir denken an die Libanesin Fairuz (geb. 1934), die noch vor dem Bürgerkrieg in den 1960ern das glamouröse Bild von Beirut als »Paris des Nahen Ostens« kulturell mitprägte. Die syrisch-orthodoxe Christin öffnete mit ihrem Komponisten- und Produzenten-Duo, den Gebrüdern Rahbani, die arabische Liedkunst für Einflüsse aus dem Westen. Man entwarf eine Vielzahl von teils gesellschaftskritischen Musicals, spielte mit der Befruchtung durch Folklore, Latin und auch durch Jazz.
Neues arabisches Lied
Später dann beherrschte der wilde, ungestüme Raï aus Algerien das Bild der arabischen Musik in unseren Breiten, dominiert von den »Chebs«, den »Kerlen« wie Khaled und Mami. Und dann, Ende der Neunzigerjahre, kam plötzlich Souad Massi, und mit ihr erstand das arabische Lied neu, bekam aber ein ganz anderes Gesicht. Eines, das weltoffen mit französischem Chanson und anglo-amerikanischem Folk turtelte, das sich an Flamenco-Rhythmen aus Andalusien und der Rumba aus Zentralafrika interessiert zeigte. Neu war auch die Art der Texte, die den Gefühlsschattierungen einer weiblichen Seele viel Platz einräumen, wo zuvor oft Herzschmerz-Schablonen oder Romantizismen an der Tagesordnung waren.

»In einem meiner Lieder vergleiche ich Algerien mit einer schönen Frau, die gefesselt ist und der niemand zuhört«, sagt Souad Massi. Es ist eine Erfahrung, die sie selbst kennt. 1972 in Bab El-Oued, einem Arbeitervorort von Algier, in eine arme Familie mit sechs Geschwistern geboren, wächst sie mit dem heimischen Chaâbi, einer Popmusik mit berberischen und arabischen Einflüssen, ebenso auf wie mit der Rockmusik des Westens. Gleichzeitig ist sie fasziniert vom Flamenco. Sie wird Algeriens erste Heavy-Metal-Sängerin – und damit fangen die Probleme in der von Fundamentalisten unterwanderten Gesellschaft an. Massi erhält Morddrohungen am Telefon, die Proben der Band werden wegen der Ausgangssperre während des Bürgerkrieges, der 1991 ausbricht, unmöglich. Es schließen sich frustrierende Jahre als Stadtplanerin an. Erst eine Einladung aus Paris, zum Festival »Femmes d’Algérie«, bringt sie 1999 zurück zur Musik.
Heute ist Souad Massi, deren Vorfahren den kabylischen Berbern aus dem nordalgerischen Teil des Atlas-Gebirges angehörten, eine der wichtigsten Interpretinnen des modernen arabischen Liedes. Im französischen Exil hat sie sich schon mit ihren frühen Alben »Raoui« und »Deb« Anfang des Jahrtausends eine eigene Nische in diesem Genre geschaffen. Denn da sind kaum je üppige Streichorchester oder arabeske Ornamente zu hören. Sie mischt vielmehr den so geliebten Flamenco, ebenso Chanson und Folk in ihre Klangsprache. Daneben finden sich Töne aus der süffig-süßen kapverdischen Morna und der kongolesischen Rumba. Früh schon arbeitet Massi mit dem Starproduzenten Jean Lamoot, der auch in Diensten von Frankreichs Rock-Helden Noir Désir stand, singt im Duett mit dem Chansonnier Francis Cabrel und der Pop-Ikone Paul Weller.
Geschichten von Exil und Entwurzelung
Das Folk-Flair bringt ihr Vergleiche mit Joan Baez und Tracy Chapman ein, doch ihre Stimme ist sanfter, melancholischer; ihre Texte, die sie auf Arabisch, Kabylisch und Französisch vorträgt, sind selten offen politisch. Vielmehr erzählt sie Familiengeschichte(n) vor dem Hintergrund von Exil und Entwurzelung und gibt so einen Einblick in die Umbrüche der Welt aus ihrer selbst erlebten Perspektive. Etwa wenn sie vom Schicksal einer entwurzelten Algerierin im Großstadtgetriebe der Fremde singt, wie in ihrem wunderbar traurigen Lied »Yemma«. Oder von der wehmütigen Erinnerung an das Haus ihres Großvaters in »Dar Dgedi«.
Alte Lyrik, die ins Herz geht
Doch Massi blickt auch in die arabische Historie und vertont Jahrhunderte alte Lyrik von Poeten und Poetinnen. »Ich war so genervt davon, welche Bilder mit der arabischen Kultur assoziiert werden«, sagte sie zur Veröffentlichung ihres Albums »El Mutakallimûn« 2015. »Wir werden heute wie Tiere porträtiert, dabei waren es meine Vorfahren, die die Medizin erfunden haben.« In der alten Poesie entdeckte sie einen Gegenentwurf zum omnipräsenten Hautgout von Terror und Extremismus, wie er in den Medien seit 9/11 vorherrscht. »Als ich diese Lyrik las, wurde ich in einem Überfluss von Schönheit gebadet.« Ihre Vertonungen der tausend Jahre alten Gedichte von Al Mutanabbi und anderen Lyrikern des alten arabischen Weltreiches gehen direkt ins Herz.
Mit ihrem nächsten Album »Oumniya« (2019) überrascht Souad Massi erneut: Politischer denn je zuvor greift sie die Oligarchie Algeriens an, die das Land kaputt gemacht hat, und sie ergreift das Wort gegen die immer noch gängige Praxis der Zwangsverheiratung.
Arabische Farben, Chanson und Bossa Nova
Auf ihrer bislang letzten und zehnten Arbeit, »Sequana« (2022), bleibt sie sich nach wie vor treu in der Vermählung arabischer Farben mit Chanson-Flair und folkiger Gitarre. Dieses Mal ist aber auch ein Hauch Bossa Nova dabei und sogar ein Tupfer Hardrock. Massis Stimme ist gereift, was ihren melancholischen Liedern noch mehr Tiefe verleiht, den kraftvollen dagegen eine bezwingende Souveränität.
Mit Gänseblümchen verschließt sie auf dem Cover von »Sequana« ihre Augen. In einer Zeit des blanken Hasses zwischen den Völkern und einem Erstarken von Diktatoren und rechtsextremen Parteien mag das zunächst wie Weltflucht aussehen. Doch da wäre man auf dem Holzweg: »Meine aktuellen Lieder handeln von menschlichen Beziehungen, vom Unbehagen der heutigen Jugend und der Orientierungslosigkeit bis hin zu den Gefahren totalitärer Regime, die Menschen dazu bringen, schreckliche Risiken einzugehen, um aus ihrem Land zu fliehen«, sagt Massi.
»Dessine-moi un pays« ist ihre Widmung an das vom Westen im Stich gelassene afghanische Volk; die Bilder von den Menschen, die sich an Flugzeuge klammern, hatte sie dabei vor Augen. Im Titelstück schweift sie zurück zur Sage von der gallo-römischen Flussgöttin Sequana, die die heilende Wirkung des Wassers verkörpert – was man bei Massi durchaus allegorisch verstehen darf. In anderen Stücken ergreift sie Partei für die Jugend, die im digitalen Alltag zweifelhaften Vorbildern folgt. Und im tänzerischen »Une seule étoile« mahnt sie etwas an, was uns verloren gegangen scheint: Demut gegenüber der Natur, Güte gegenüber dem Nächsten. Schließlich ist eines der neuen Lieder auch einem unerschrockenen Kollegen und Kämpfer für die Freiheit gewidmet, dem vor mehr als 50 Jahren ermordeten chilenischen Volkssänger Víctor Jara.
Eine Singer-Songwriterin ohne Allüren, wie sie kein Marketingschachzug kreieren könnte: Auf der Bühne ist es Souad Massis entwaffnende Natürlichkeit, die das Publikum in Bann zieht. Dann kann es sein, dass sogar Tränen fließen, auf beiden Seiten. In ihrer Stimme, die sie in ein Sextett rund um ihren langjährigen Begleiter, den Perkussionisten Rabah Khalfa, bettet, wohnt neben dem Zauber der immer präsenten Wehmut auch die Kraft, Wunden zu heilen. Oder, um es mit dem Motto zu sagen, das Souad Massi ihrem aktuellen Programm eingeschrieben hat: »Dein Leben ist eine Rose. Gieße sie und vergiss ihre Dornen.«
Dieser Artikel erschien im Elbphilharmonie Magazin (Ausgabe 1/25).
- Elbphilharmonie Großer Saal
»Sequana«
LivestreamVergangenes Konzert